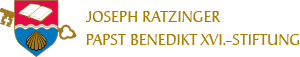Zum Artikel in der NYT
Jahr der Priester
Erste Benediktakademie
Zur ökumenische Initiative von Papst Benedikt XVI.
Zum Papstbesuch im Heiligen Land.
Stephan Otto Horn
Der Papst hält den Kurs des Konzils
Kritische Beobachtungen zu Peter Hünermanns „Excommunicatio-Communicatio“
Peter Hünermann, ehemals Gründungspräsident der Europäischen Gesellschaft für Katholische Theologie, gibt seiner Stellungnahme zu den Ereignissen der letzten Wochen, die nach ihm einen „Scherbenhaufen ungeheuren Ausmaßes“ zurückgelassen haben („Excommunicatio-Communicatio“, Herder Korrespondenz, März 2009) den Untertitel „Versuch einer Schichtenanalyse der aktuellen Krise“. Wer nun meint, er werde eine umfassende Analyse der ganz unterschiedlichen Gründe für die Geschehnisse erhalten, findet sich in seinen Erwartungen nicht bestätigt. Hünermann lenkt den Blick rasch auf Benedikt XVI. in dessen Entscheidung, die Exkommunikation der vier Bischöfe der Piusbruderschaft aufzuheben, glaubt er den entscheidenden Grund für die Erschütterungen in der Kirche gefunden zu haben. So sucht er in seiner Analyse die geschichtlichen Hintergründe der Entwicklung der Lefebvre-Bewegung und der Haltung Roms ihr gegenüber aufzuhellen. Vor allem prüft er das Handeln von Papst Benedikt und kommt zum Schluß er habe eine Entscheidung getroffen, die keine Gültigkeit beanspruchen könne. Sie sei gravierend, ja bedeute geradezu einen skandalösen „Amtsfehler“, weil Papst Benedikt damit nicht mehr voll für die Geltung des Zweiten Vatikanischen Konzils einstehe. Er befürchtet zugleich eine nachkonziliare pastorale Kurskorrektur des Papstes.
Das sind Thesen, die aufwühlen, Anklagen, die vielen plausibel erscheinen mögen. Sie bedürfen umso mehr der Prüfung, als sie gegen den Papst als Hirten der universalen Kirche erhoben werden und außerordentlich folgenreich für die Kirche besonders in den deutschsprachigen Ländern sein können. Als Schüler von Joseph Ratzinger fühle ich mich verpflichtet, Professor Hünermann zu antworten. Ich versuche zu zeigen, dass er keine zutreffende Deutung der Entscheidung des Papstes gibt und dessen Intentionen nicht gerecht wird.
Was mag den Papst bewogen haben, die Sache in die Hand zu nehmen?
Was mag Papst Benedikt bewogen haben, diese Sache überhaupt in die Hand zu nehmen? Welche Erfahrungen haben ihn dazu geführt, einen solchen Vorstoß zu machen? Diese Frage führt mich zurück zum Augenblick seiner Wahl. Schon seine erste Ansprache an die Kardinäle nach seiner Wahl zeigt, wie sehr sich Benedikt XVI. der ökumenischen Aufgabe verpflichtet weiß und wie sehr er sie als genuinen Auftrag seines petrinischen Amtes sieht. Wer seine Worte damals hörte, dachte freilich vor allem an die Gespräche mit den orthodoxen Kirchen, mit dem Anglikanismus und mit den aus der Reformation erwachsenen kirchlichen Gemeinschaften. Beim neu gewählten Papst dürfte es nicht anders gewesen sein. Aber nun klopfte bald danach der Leiter einer stark wachsenden Gemeinschaft, der exkommunizierte Bischof Bernard Fellay, an seine Tür. Konnte er ihn und damit seine Gemeinschaft, die immer noch zum Schisma tendierte, einfach abweisen? Genügte es, ihm in Milde Vorwürfe zu machen, wie Papst Benedikt es nach dem Zeugnis von Fellay damals tat?
Es liegt nahe, sich zunächst zu fragen, welche Einsichten sich Joseph Ratzinger aus Erfahrungen aufdrängten, welche die Kirche mit Minoritäten im Umkreis des Vatikanum I gemacht hatte. Für die Haltung von Papst Paul VI. gegenüber Konzilsminoritäten im Zweiten Vatikanischen Konzil und von Kardinal Ratzinger in den nachkonziliaren Streitigkeiten um das Konzil dürften diese Erfahrungen maßgebend geworden sein. Im Ersten Vatikanischen Konzil hatte die große Majorität der Bischöfe, nachdem die großen Klärungen und Entscheidungen bei der Behandlung der Infallibilitätsfrage vollzogen waren, sich nicht mehr bereit gefunden, einige relativ bescheidene Vorschläge der Minorität in den letzten Textfassungen zu berücksichtigen, obwohl es ihr möglich gewesen wäre. Die noch widerstrebenden Bischöfe konnten erst nach dem Konzil durch Erläuterungen für die Annahme des konziliaren Dokumentes gewonnen werden. Die Bemühungen seitens der Kirche um die Bewegung, die mit dem Namen von Ignaz von Döllinger verbunden ist, waren jedoch nach dem Konzil nicht kraftvoll und geduldig genug, um das Entstehen des altkatholischen Schismas zu verhindern. Es gelang der Kirche nicht, allen Gläubigen überzeugend zu zeigen, dass das Konzil nicht jene extreme Form von unfehlbarer Glaubensfestigkeit des Papstes definiert hatte, gegen die Döllinger Sturm gelaufen war.
Um ein Schisma zu verhindern, galt es rasch zu handeln
Papst Paul VI. versuchte auf dem Vatikanum II ähnliche Fehler zu vermeiden und drängte in einzelnen Fällen noch im letzten Augenblick zu Gunsten der Minorität auf Modifikationen, die auch von der Majorität bejaht werden konnten. Es lag ihm sehr daran, daß der endgültige konziliare Text möglichst von allen Konzilsvätern mitgetragen wurde. Und Kardinal Ratzinger bemühte sich sehr früh um Erzbischof Lefebvre und seine Bewegung, nachdem dieser seine ursprüngliche Zustimmung zu einzelnen Konzilsdokumenten zurückgezogen hatte. Damit ein Schisma verhindert werden konnte, galt es rasch und entschieden zu handeln. So trat Ratzinger in Verhandlungen mit Lefebvre ein.
1988, das Jahr des Erfolgs in den Bemühungen um Einigung mit ihm wurde unglücklicher Weise auch zum Augenblick des Scheiterns der Gespräche. Erzbischof Lefebvre widerrief seine Unterschrift unter einen mit Kardinal Ratzinger kurz zuvor vereinbarten Text und begann mit der Weihe von vier Bischöfen seinen eigenen, zum Schisma tendierenden Weg zu gehen. Er tat dies, obwohl er wissen musste, dass er sich und den Beteiligten dadurch nach dem Kirchenrecht automatisch die Beugestrafe der Exkommunikation zuzog. Diese wurde durch ein römisches Dekret bestätigt. Nach gut 20 Jahren, am 21. Januar 2009, mitten in der Weltgebetsoktav um die Einheit der Christen, hob Papst Benedikt diese Strafe auf.
Er hob damit eine „Beugestrafe“ auf – eine Strafe, die auf Umkehr zielt und erlassen werden muß, wenn sie das Ziel erreicht, nämlich zur Aufgabe der Widersetzlichkeit geführt hat. Die Exkommunikation ist eine außerordentlich schwere Beugestrafe, da sie das kirchliche Leben eines Christen sehr beeinträchtigt. Er darf bis zu ihrer Aufhebung keine Dienste mehr bei einer gottesdienstlichen Feier verrichten, keine Sakramente empfangen oder spenden und keine kirchlichen Ämter und Dienste mehr ausüben. Hünermann sieht in der Aufhebung der Exkommunikation für die, welche an der illegitimen Weihe im Jahr 1988 beteiligt waren, mehr als nur die Aufhebung der genannten drastischen Einschränkungen. Dieser Akt gewährt vielmehr auch „den leitenden Bischöfen der Piusbruderschaft ohne die kanonische Voraussetzung in grundsätzlicher Weise die Kirchengemeinschaft – die Aufhebung des Schismas
-, allerdings ohne näher zu bestimmen, welchen Status sie in der Kirche haben werden“. Damit hat nach seiner Auffassung Papst Benedikt eine Entscheidung getroffen, die gegen Glaube und Sitte verstößt, da er mit ihr diese Bischöfe von der vollen Annahme des Zweiten Vatikanischen Konzils dispensiert (befreit) hat.
Die wichtigste Anfrage an die Argumentation von Peter Hünermann bezieht sich m. E. auf dessen Auffassung, die Aufhebung einer Exkommunikation gewähre in grundsätzlicher Weise „die Aufnahme in die Gemeinschaft der Kirche“. Bevor ich diesen Sachverhalt erörtere, möchte ich zunächst ein anderes zentrales Element der Hünermannschen Interpretation aufnehmen. Er sucht zu zeigen, dass bei Bischof Fellay und den drei anderen illegitim geweihten Bischöfen keine Reue erkennbar sei. Da Reue Voraussetzung für die Aufhebung der Exkommunikation ist, ist in den Augen von Hünermann ihre Aufhebung und so auch die Gewährung der vollen kirchlichen Gemeinschaft ein ungültiger, „nichtiger“ Akt des Papstes.
Die Aufhebung der Exkommunikation – ein ungültiger Akt?
Peter Hünermann begründet sein Urteil zunächst mit Can. 1347-§2 des CIC/1983, der von der Aufhebung einer Straftat spricht. Nach diesem Text zeigt sich an der Reue, dass der Täter seine Widersetzlichkeit (contumacia) aufgegeben hat. Hünermann vertritt nun die Auffassung, an verschiedenen Äußerungen von Fellay zeige sich, „dass hier in keiner Weise eine Veränderung stattgefunden“ habe. Blicken wir näher zu! Papst Benedikt hat selber die Begründung für seine Aufhebung der Exkommunikation vorgelegt. Sie findet sich im Dekret der Aufhebung der Exkommunikation vom 21. Januar, das von Kardinal Re unterzeichnet ist. Dabei bezieht der Papst sich auf das Schreiben von Bischof Bernard Fellay vom 15. Dezember.
Kardinal Re beschreibt die Auffassung des Papstes so: „Papst Benedikt hat – bewegt von väterlichen Empfindungen angesichts der von den Betroffenen bekundeten geistlichen Notlage wegen der erfolgten Exkommunikation und im Vertrauen auf ihre in dem genannten Schreiben geäußerte Verpflichtung, keine Mühe zu scheuen, um die Gespräche mit dem Heiligen Stuhl in den noch offenen Fragen zu vertiefen und dadurch zu einer vollständigen und befriedigenden Lösung des entstandenen Problems zu gelangen – beschlossen, die kirchenrechtliche Situation der Bischöfe…neu zu bedenken, die durch ihre Bischofsweihe entstanden war.“ Dieses Überdenken ergab und bedeutete die Aufhebung der Exkommunikation.
Für die Entscheidung des Papstes ist also neben der geistlichen Notsituation die Bereitschaft maßgebend, mit dem Heiligen Stuhl die offenen Fragen zu besprechen. Das bedeutet nicht zuletzt, die Vorbehalte der Bruderschaft gegenüber bestimmten Dekreten des Konzils gemeinsam zu erörtern und ihre Übereinstimmung mit der kirchlichen Tradition zu prüfen. So hatte der Heilige Stuhl schon von der Gruppe, die sich zur Petrusbruderschaft entwickelte, gefordert, „unter Vermeidung jeder Polemik sich zu einer Haltung des Studiums und der Kommunikation mit dem Heiligen Stuhl bezüglich der Punkte zu bekennen, die vom Zweiten Vatikanum gelehrt werden, beziehungsweise der späteren Reformen, die den Unterzeichnern nur schwer mit der Tradition vereinbar scheinen“. Es ist höchst erstaunlich, dass Peter Hünermann die grundlegende Begründung des Papstes für sein Handeln, die dieser im Dekret vorlegt, überhaupt nicht in seine Beurteilung aufgenommen hat.
Für das volle Verständnis dieser Begründung ist auch ein Wort aus dem Schreiben von Fellay wichtig, das Kardinal Re im Dekret zitiert: „Wir sind immer vom festen Willen bestimmt, katholisch zu bleiben und alle unsere Kräfte in den Dienst der Kirche unseres Herrn Jesus Christus zu stellen, welche die römische katholische Kirche ist. Wir nehmen ihre Lehren mit kindlichem Geist an. Wir glauben fest an den Primat des Petrus und alle seine Vorrechte und deshalb lässt uns die aktuelle Situation sehr leiden.“ Damit anerkannte Fellay besonders die einzigartige Stellung des Dialogpartners, des Papstes als des Inhabers primatialer Vollmachten. Bereitschaft zum Dialog, Betonung der päpstlichen Autorität: all das konnte Papst Benedikt zu Recht als Zeichen für eine gewisse Bereitschaft betrachten, die Widersetzlichkeit aufzugeben. Die volle und endgültige Umkehr erhofft er sich von den Gesprächen und von der Bejahung des Konzils aufgrund seiner authentischen Deutung.
In seinem Brief vom 15. Dezember hatte Bischof Fellay andrerseits von Vorbehalten gegenüber dem Konzil gesprochen: „Wir sind bereit, mit unserem Blut das Credo niederzuschreiben, den Antimodernismuseid zu unterzeichnen und das Glaubensbekenntnis von Pius IV. Wir akzeptieren und machen uns alle Konzilien bis zum Ersten Vatikanum zu eigen. Aber wir kommen nicht umhin, in Bezug auf das Zweite Vatikanum unsere Vorbehalte zum Ausdruck bringen.“
Aus der außerordentlichen Entschiedenheit, die in solchen Texten zu Tage tritt, liest Peter Hünermann ab, dass „hier in keiner Weise eine Veränderung stattgefunden“ habe. Das rechte Verständnis der Glaubenstradition und die Überwindung der Vorbehalte gegenüber dem Vatikanum II gehören freilich zu den noch offenen Fragen, in denen die Differenzen scharf hervortreten. Eine Änderung der Haltung ist hier noch kaum spürbar, es sei denn darin, dass das Vatikanum II nicht einfach verworfen wird. Aber diese Fragen sind nun hinein genommen in die Bewegung zur Bemühung um ein neues tieferes Verständnis, das im Gespräch mit dem Heiligen Stuhl gesucht werden soll. Darin zeigt sich, dass die ursprüngliche Tendenz der Bruderschaft zu einer schismatischen Haltung und zur Beharrung darin sich zu einer Ausrichtung auf Einheit hin gewandelt hat. Mit Widersetzlichkeit kann diese neue Haltung nicht mehr zureichend beschrieben werden. Sie bedeutet eine echte Änderung der Gesinnung, andererseits noch keine volle Umkehr, die einen Rechtsanspruch auf die Aufhebung verleihen würde.
Nach Can. 1347-§2 steht die Aufhebung einer Beugestrafe am Ende eines Weges der Umkehr und bedeutet dann die Erfüllung eines Rechtsanspruchs. Papst Benedikt sieht nun aber eine außerordentliche Situation vor sich: die Möglichkeit und Hoffnung, einen Weg zur Umkehr, der schon beschritten wurde, aber freilich noch bei weitem nicht zu Ende gegangen ist, durch eine Aufhebung der Exkommunikation zum Ziel hinführen zu können. Eine solche Aufhebung erwächst in diesem Fall freilich nicht aus einem Rechtsanspruch, sondern wird von Benedikt XVI. als ein Akt der Barmherzigkeit verstanden. Damit geht er offenkundig über das bestehende Gesetz hinaus. Aber liegt seine Entscheidung nicht doch im Sinne des Gesetzes? Erfüllt sie nicht den tieferen Sinn des Kirchenrechts?
In der außerordentlichen Situation, vor der Papst Benedikt stand, war eine Aufgabe der Widersetzlichkeit am ehesten dann – wenn überhaupt – zu erreichen, wenn durch die erbetene Aufhebung der Exkommunikation der Weg des Dialogs entschieden beschritten und weitergeführt werden konnte. Die Fortdauer der Beugestrafe war in diesem Augenblick nicht mehr zielführend. Wir stehen hier freilich vor einer Situation, die von außen her nicht voll erfasst, sondern zu einem guten Teil nur vom Papst beurteilt werden kann, da er allein den ganzen bisherigen Weg aus nächster Nähe verfolgen konnte. Aus dem mündlichen und schriftlichen Dialog mit Bischof Fellay kam er offensichtlich zur Überzeugung, es gebe bei ihm und der Bewegung von Erzbischof Lefebvre derzeit einen ansatzhafte, aber echte Bereitschaft zur Versöhnung, die auf eine künftige volle Aufgabe der Widersetzlichkeit hoffen ließ, die aber ohne die Aufhebung der Exkommunikation nicht fruchtbar gemacht werden konnte. Er handelte also nicht gegen den Sinn des Gesetzes, sondern in dessen Sinn. Vor allem handelte er in der vom Evangelium vorgezeichneten Haltung des Hirten, der die neunundneunzig Schafe zurücklässt, um das eine zu suchen.
Die eigentliche Mitte der Argumentation von Hünermann
Von da aus können wir nun zur eigentlichen Mitte der Argumentation von Hünermann vortoßen. Er bezeichnet das Handeln des Papstes nicht nur als eine einfache, sondern als gravierende, ja sogar skandalösen Fehlentscheidung, mit der er seine eigene Autorität beschädige: Dieser Akt „ist ein gravierender Amtsfehler, da er eine Dispens von der vollen Annahme des Zweiten Vatikanischen Konzils bedeutet… Dieser gravierende Amtsfehler richtet sich gegen fides et mores, gegen Glaube und Sitte, deren Wahrung dem Nachfoler Petri in besonderer Weise für die universale Kirche anvertraut ist.“
Hünermann betont, dass der Papst das Konzil nicht leugne, sondern verstehe. Aber die Aufhebung der Exkommunikation und die (seiner Meinung nach) damit gegebene „Beendigung des Schismas“ bedeute, dass Bischöfe wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen sind, die wesentliche Elemente des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht bejahen,. So habe Benedikt XVI. in den Augen der Gläubigen seine petrinische Autorität untergraben: „Der Papst hat durch seine Amtsführung das Vertrauen der Gläubigen in den Dienst des Petrus als Zeugen von Glauben und Sitte zutiefst erschüttert. Zugleich bringt er durch seine Entscheidung die Kirche in Gefahr, Bischöfe und Priester zu haben und künftige Bischöfe kirchlicherseits auszubilden, die sich nicht zu Glauben und Sitte der katholischen Kirche bekennen.“
Hünermann kommt zu derart schweren Anklagen durch eine durchaus fragwürdige Auslegung des Aktes der Aufhebung der Exkommunikation. Er sieht in der Aufhebung der Exkommunikation die grundsätzliche Gewährung der Kirchengemeinschaft, die Aufhebung des Schismas. Dies bedeutet für ihn, wie wir sahen, zugleich eine „Dispens von der vollen Annahme des Zweiten Vatikanischen Konzils“, die Glaube und Sitte verletzt. „Es stellt sich die Frage, ob ein Papst von einem gültig zustandegekommenen Konzil dispensieren kann, so dass dieses Konzil lediglich mit Aussparung wesentlicher Aussagen angenommen wird. Die Antwort ist ein glattes Nein.“ Man wird Hünermann nicht darin widersprechen können, dass es hier um wesentliche Aussagen geht, „die für die Kirche in der geschichtlichen Situation der Moderne unhintergehbar sind“. Aber solange die Bischöfe, die nun nicht mehr exkommuniziert sind, noch nicht zur Anerkennung des Zweiten Vatikanum gefunden haben, stehen sie gemäß dem Dekret von Papst Benedikt noch nicht in der vollen Gemeinschaft der Kirche. So heißt es im Dekret: „Es ist zu hoffen, dass diesem Schritt (der Aufhebung der Exkommunikation) die baldmögliche Verwirklichung der vollen Gemeinschaft von seiten der gesamten Bruderschaft St. Pius X. mit der Kirche folgt…“
Ferner kann man auch nicht sagen, der Papst dispensiere (befreie) in seinem Akt von der Annahme des Konzils. Eine solche Annahme kann er nicht
einfach erzwingen. Er kann aber auch nicht davon befreien. Vielmehr will er die Mitglieder der Bruderschaft durch seinen Akt der Barmherzigkeit und den durch sie ermöglichten Dialog dazu hinführen, es anzuerkennen.
Der Papst hat also nicht Glaube und Sitte verletzt und auch nicht seine petrinische Autorität beschädigt, sondern mit seinem Akt gegenüber einer nicht mehr so kleinen Gemeinschaft ein mutiges Zeichen für den ökumenischen Dialog gegeben. Diese Absicht lässt er am Schluß des Dekrets zum Ausdruck bringen. Das „Geschenk des Friedens soll – am Ende des weihnachtlichen Festkreises – auch ein Zeichen des Papstes sein, um die Einheit in der Liebe der Universalkirche zu fördern und das Ärgernis der Spaltung zu überwinden.“
Hat Benedikt XVI. einen Kurswechsel für die Kirche im Sinn?
Papst Benedikt XVI. hat in seiner „Neujahrsansprache an das Kardinalskollegium und die Mitglieder der Römischen Kurie beim Weihnachtsempfang“ (22. Dezember 2005) das Thema der Deutung des Zweiten Vatikanischen Konzils behandelt. Damit eröffnet sich uns die Möglichkeit, seine Stellung zum Zweiten Vatikanum in den Blick zu nehmen und zu sehen, wie er eine Linie vorgibt, die gerade für die Lösung der Probleme, welche die Piusbruderschaft umtreibt, von grundlegender Bedeutung ist. Die vom Papst aufgezeigte Linie lässt hoffen, dass deren Mitglieder aufgrund einer wahrhaft authentischen Interpretation zu einer echten Bejahung des ganzen Konzils finden. Wenn dies nicht erreicht werden kann und das Ziel der vollen Einheit verfehlt würde, wäre das freilich ein tragisches Geschehen.
Der Papst sieht in der genannten Ansprache die Verwirrungen der nachkonziliaren Zeit und die nur langsam sich einstellenden guten Früchte des Konzils als Ergebnis zweier entgegengesetzter Hermeneutiken. Die eine nennt er „Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruches“. Er weist dabei darauf hin, dass eine solche Hermeneutik „das Risiko eines Bruches von vorkonziliarer und nachkonziliarer Kirche“ in sich trage, und zeigt, dass ihre Vertreter, indem sie über die Konzilstexte hinausgehen und nicht ihnen, sondern ihrem Geist folgen wollen, keine klare Linie finden können, sondern „Raum für Spekulationen“ schaffen. Die zweite Hermeneutik nennt er nicht, wie man es erwarten möchte, „Hermeneutik der Kontinuität“, sondern „Hermeneutik der Reform“, betont also ihre dynamische Dimension. Er leitet sie aus der Konzeption von Johannes XXIII. für das Zweite Vatikanische Konzil ab. Dabei verweist er auch auf folgendes Wort des Papstes: „… Es ist notwendig, die unumstößliche und unveränderliche Lehre, die treu geachtet werden muß, zu vertiefen und sie so zu formulieren, dass sie den Erfordernissen unserer Zeit entspricht.“ Das heißt für Benedikt XVI., die Wahrheit in ihrem Sinn und ihrer Tragweite zu bewahren, sie aber zugleich neu zu verstehen und zu leben.
Peter Hünermann begrüßt die Überzeugung des Papstes, dass die Kirche „sich, vom Glauben geleitet, in der modernen Welt neu positionieren musste“. Zugleich beklagt er aber, dass dieser bei der Darstellung der Diskontinuität “ zwar auf die ‚Progressisten’ „in keiner Weise“ aber auf die Traditionalisten anspiele. Es zeige sich an seinem Text, „dass Benedikt XVI. das Konzil bejaht, die Gefährdung der Rezeption des Konzils aber völlig einseitig sieht“. Er erkühnt sich sogar zu behaupten: „Der Papst sieht die Akzeptanzkrise der Kirche in der modernen Welt und ist der Überzeugung, dass in der Rückgewinnung ganz traditioneller Kreise die Zukunft der Kirche liegt.“ Bedeutet das nicht, dass nach seiner Auffassung Benedikt XVI. einen scharfen Kurswechsel für die Kirche in ihrer nachkonziliaren Epoche im Sinn hat?
Hünermann bietet für seinen Verdacht freilich nur einen äußerst schwachen Beleg. Er zeigt sich irritiert, dass der Papst, wie soeben angedeutet, bei der Kritik der Hermeneutik der Diskontinuität nicht auch auf Traditionalisten anspiele. Aber er übersieht, dass der Papst sich nicht damit begnügt, die beiden Hermeneutiken der Diskontinuität und des Bruches auf der einen und der Reform auf der anderen Seite einander gegenüberzustellen. Überraschenderweise denkt Benedikt XVI. nämlich noch ausgiebig über die Möglichkeit einer anderen Form der Hermeneutik der Diskontinuität nach, die nicht zugleich eine Hermeneutik des Bruches ist. Und hier findet sich die von Hünermann vermisste sehr ausführliche Auseinandersetzung mit traditionalistischen Positionen. In ihr vollzieht der Papst eine Kritik, durch die er aber vor allem überzeugen will. Hier zeigt sich überdeutlich, dass Benedikt XVI. die Gefährdung der Rezeption des Konzils gerade nicht einseitig sieht.
Sehen wir näher zu! Papst Benedikt nimmt in seinen Überlegungen über die zweite Gestalt einer Hermeneutik der Diskontinuität eine Anregung von Papst Paul VI. aus dessen Rede zum Abschluß des Konzils auf. Er tut dies nicht im Blick auf die großen dogmatischen Texte, sondern auf diejenigen, in denen die Konzilsväter das Verhältnis von Kirche und Modernität neu bestimmen mussten. Hier führten die ganz unterschiedlichen geschichtlichen Situationen zu einem „Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität auf verschiedenen Ebenen“, als „Entwicklungsprozeß des Neuen unter Bewahrung der Kontinuität“. Es würde zu weit führen, die Erwägungen des Papstes im Detail nachzuzeichnen. Jedenfalls berührt er die Themen Kirche und moderner Staat, religiöse Toleranz, Religionsfreiheit, Gewissens- und Glaubensfreiheit, Themen also, die einen ersten Platz im Gespräch mit der von Lefebvre herkommenden Bewegung einnehmen werden. Der Papst kommt zum Schluß: „Das Zweite Vatikanische Konzil hat durch die Neubestimmung des Verhältnisses zwischen dem Glauben der Kirche und bestimmten Grundelementen des modernen Denkens einige in der Vergangenheit gefällte Entscheidungen neu überdacht oder auch korrigiert, aber trotz dieser scheinbaren Diskontinuität hat sie ihre wahre Natur und ihre Identität bewahrt und vertieft. Die Kirche war und ist vor und nach dem Konzil dieselbe…“
Wir sehen, wie es dem Papst gelingt, die Diskontinuitäten in einer tieferen Kontinuität aufgehoben zu sehen. So gibt er in souveräner Weise die Linie vor, in der der Heilige Stuhl die Gespräche mit der Piusbruderschaft führen kann. Ihm liegt daran, sie argumentativ zur Anerkennung des Zweiten Vatikanischen Konzils zu bewegen. Im ganzen zeigt sich, dass Papst Benedikt die Hermeneutik des Konzils in der Linie fortführt, die Papst Johannes XXIII. und Paul VI. vorgezeichnet haben. Er hält den Kurs des Konzils. Für die Auslegung ist ihm maßgebend im Bereich der dogmatisch geprägten Texte eine Hermeneutik der Kontinuität und der Reform, im Bereich jener Texte, die sich auf die Fragen der Begegnung von Kirche und moderner Welt beziehen, eine Hermeneutik der tieferen Kontinuität inmitten von Diskontinuität.
Nach dieser Sicht der Dinge ist nicht die Amtsführung des Papstes der wirkliche Grund für die Erschütterung, welche die Kirche besonders in den deutschsprachigen Ländern getroffen hat. Eine umso wichtigere Aufgabe ist es für alle, unberechtigte Beschuldigungen von Benedikt XVI. fernzuhalten oder sie zurückzunehmen. Sie beschädigen seine Autorität in den Augen der Gläubigen in erheblichem Maß. Peter Hünermann zeigt sich der Richtigkeit seiner Analysen freilich so sicher, dass er gegen Ende seiner Ausführungen in aller Schärfe zu sagen wagt, es sei „unabdingbar, dass die (vom Papst) getroffenen Entscheidungen nichtig sind“. Sie müßten von Kardinal Re oder noch besser von Papst Benedikt zurückgenommen werden. Noch einmal erhebt er die gravierende Anklage, das Handeln von Papst Benedikt stelle einen skandalösen Amtsfehler dar. Er mildert sie dann aber doch beträchtlich ab, indem er nun hinzufügt: „meines Erachtens – und ich betone: salvo meliori iudicio (vorbehaltlich eines besseren Urteils)“. Es wird Peter Hünermann ehren, wenn er die Suche nach einem besseren Urteil von neuem aufnimmt.